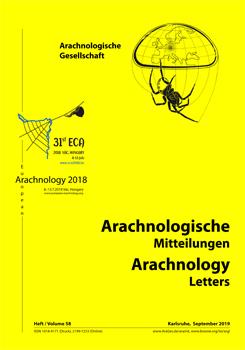Städte können zum Erhalt der Biodiversität beitragen, da sie oft wertvolle Ersatzlebensräume für Tiere und insbesondere Invertebraten bieten. In diesem Zusammenhang hat Berlin - als grüne Hauptstadt - ein großes Potenzial, so dass Biodiversitätserhebungen zur Erhöhung der Datenverfügbarkeit zwingend erforderlich sind. Vor allem städtische Trockenrasen können eine hohe Diversität aufweisen, wurden aber bisher nur sporadisch untersucht. Die vorliegende Studie gibt eine erste umfassende Artenliste für Spinnen in Trockenrasen Berlins und dem angrenzenden Brandenburg. Insgesamt wurden im Jahre 2017 mittels Bodenfallen 52 Standorte befangen. Die Untersuchung erbrachte 194 Arten aus 18581 Individuen. Von den 194 Arten sind 33 Arten in Berlin gefährdet, von diesen gelten neun Arten als ausgestorben. Weiterhin konnten 18 Arten mit einem Gefährdungsstatus in Brandenburg nachgewiesen werden. Talavera aperta wurde erstmals in Berlin erfasst und Metapanamomops kaestneri sowie Sibianor tantulus sind bundesweit sehr selten. Unsere Ergebnisse zeigen, dass Städte ein enormes Potenzial für den regionalen und landesweiten Biodiversitätsschutz haben können.
In Städten entstanden und entstehen Sandtrockenrasen zumeist durch menschliche Nutzung, so zum Beispiel in der Folge von Stilllegungen nicht mehr benötigter Verkehrs- und Industrieflächen, durch temporäre Baumaßnahmen und der damit verbundenen Einrichtung von Lagerflächen oder letztendlich auch durch militärische Nutzung (Sukopp & Wittig 1998, Langner & Endlicher 2007). Diese anthropogen geschaffenen Lebensräume haben sich immer mehr zu einem Rückzugsraum für seltene, gefährdete und zum Teil hoch spezialisierte Pflanzen- und Tierarten entwickelt (Venn et al. 2013, Melliger & Rusterholz 2017), was im Ansatz auch für Berlin belegt werden konnte (u.a. Esser & Kielhorn 2005, Czaja et al. 2013, Buchholz & Czaja 2014, Kielhorn & Kielhorn 2014). Urbane Trockenrasen können somit einen wichtigen Beitrag für den Arten- und somit Biodiversitätsschutz leisten (Tewksbury et al. 2002, Kůrka et al. 2007, Kowarik 2011, Ives et al. 2016). Um diesen Beitrag quantifizieren und bewerten zu können, damit im weiteren Verlauf auch Szenarien für die Entwicklung von Artvorkommen entworfen werden können, bedarf es einer umfassenden Datengrundlage, die nur durch Status-quo-Erfassungen und regelmäßiges Monitoring zu gewährleisten ist. Diese Daten sind auch für die Fortschreibung von Roten Listen, die Beurteilung des derzeitigen Erhaltungszustandes – vor allem der Naturschutzgebiete – und zur Kontrolle von Managementmaßnahmen unerlässlich. Auch können erfolgreiche Pflege- und Entwicklungspläne nur auf der Basis einer aktuellen und umfassenden Datenbasis entworfen werden.
Insbesondere aus faunistischer Sicht ist die Datengrundlage für urbane Trockenrasen Berlins als sehr lückenhaft zu bezeichnen. Für Spinnen liegen bis dato nur die Arbeiten von Platen et al. (1991), Czaja et al. (2013), Buchholz & Czaja (2014), Kielhorn & Kielhorn (2014) und Schäfer (2015 – Fundmeldung einer einzelnen Art) vor. Die vorliegende Studie umfasst daher erstmalig eine repräsentative arachnologische Erfassung der Trockenrasen im Berliner Stadtgebiet und im nahen Brandenburger Umland. Das Ziel dieser Arbeit ist eine kommentierte Artenliste mit einer Diskussion der für den Untersuchungsraum faunistisch interessanten Arten.
Material und Methoden
Untersuchungsgebiet
Die Studie wurde in Berlin und dem angrenzenden Brandenburg, im Nordosten von Deutschland, durchgeführt. Das Klima in dieser Region ist gemäßigt mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur von 9,1 °C und einer durchschnittlichen Niederschlagsmenge von 570 mm (climate-data.org 2018, Messzeitraum: 1982–2012). Im Jahr 2017 gab es jedoch überdurchschnittlich hohe Niederschlagsmengen von 721,4 mm mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von 9,9 °C (DWD 2017: Mittelwerte für die einzelnen Bundesländer und Gesamtdeutschland). Mit 3,6 Millionen Einwohnern auf einer Fläche von 891 km2 (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2016) ist Berlin Deutschlands bevölkerungsreichste und größte Stadt. Im Vergleich zu anderen Metropolen ist Berlin mit 48 % bebautem Gebiet, 18 % Wald, 6 % Parks und Grünflächen sowie ca. 6 % weitere unbebaute Flächen als grüne Stadt zu bezeichnen (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin 2015). Zudem führte die bewegte Geschichte der Stadt zu einer abwechslungsreichen städtischen Struktur mit urbaner Wildnis auf ehemals genutzten Flächen (z.B. Gleisanlagen, Verkehrsflächen).
Die Erfassungen erfolgten auf 52 Sandtrockenrasen in Berlin (47) und im angrenzenden Brandenburg (5) (Abb. 1, Anhang 1).Die Auswahl der Probeflächen erfolgte auf Grundlage der Biotoptypenkarten von Berlin und Brandenburg (Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 2018). Es wurden nur Flächen, die dem Biotoptyp 05120 „Trockenund Magerrasen“nach Köstler et al. (2005) entsprachen. Als weiteres Auswahlkriterium diente das Vorkommen typischer Pflanzenarten der Sandtrockentrockenrasen, welches vor Ort durch eine vegetationskundliche Vorkartierung geprüft wurde. Stark ruderalisierte Trockenrasen wurden ebenso wie freie Sandflächen von der Auswahl ausgeschlossen.
Abb. 1:
Lage der untersuchten Sandtrockenrasen im Berliner Stadtgebiet und im Berlin-nahen Brandenburg (Gewässer sind in hellgrau dargestellt, Sandtrockenrasen in dunkelgrau)
Fig. 1: Location of the investigated dry grasslands in Berlin and adjacent Brandenburg (Water bodies are shown in light grey, dry grassland in dark grey)

Datenerfassung
Die Spinnen wurden mittels Bodenfallen, einer Standardmethode zur Generierung robuster Daten auf der Grundlage von Aktivitätsdichten (New 1998), erfasst. Auf jeder Untersuchungsfläche wurden vier Bodenfallen an je einer Ecke eines 6 m × 6 m (36 m2) Quadrats eingesetzt. Die Fallen bestanden aus weißen 500 ml Plastikbechern mit einem Durchmesser von 9 cm, einer Tiefe von 14 cm und waren mit einer 4 %igen Formalinlösung gefüllt. Um Beifänge von Säugetieren, Amphibien und Reptilien zu verhindern, wurde ein Maschendraht über den Bodenfallen platziert. Die Bodenfallen waren vom 24. Apr. 2017 bis 17. Jul. 2017 und vom 1. Sep. 2017 bis 1. Okt. 2017 aktiv und wurden jeweils im Abstand von vier Wochen geleert. Die Spinnen wurden anschließend sortiert, in 75 %igem Alkohol konserviert und mithilfe von Heimer & Nentwig (1991), Roberts (1987, 1998), Almquist (2005, 2006) und Nentwig et al. (2018) bestimmt. Die Nomenklatur richtet sich nach dem World Spider Catalog (2019).
Ergebnisse
Insgesamt konnten aus 18581 Individuen 194 Arten bestimmt werden (Tab. 1, Elektronisches Supplement (Supplement.pdf)). Das entspricht 34 % der 574 in Berlin vorkommenden Spinnenarten (Kielhorn 2017). Die Anzahl erfasster Arten pro Fläche reichte hierbei von 14 bis 60 Arten, die Individuenzahlen pro Fläche variierten zwischen 63 und 903. Die mit Abstand häufigste Art war Xerolycosa miniata mit 3083 Individuen. Ebenfalls häufig war Pardosa palustris (1872 Individuen), gefolgt von Asagena phalerata (1132 Individuen) und Alopecosa cuneata (1008 Individuen).
Faunistisch interessant sind der Nachweis von Talavera aperta, der als Neufund für Berlin gilt, und der Fund der in Deutschland sehr seltenen Sibianor tantulus. Weiterhin von Interesse sind 33 Arten, die einer Gefährdungskategorie der Roten Liste der Spinnen Berlins (Kielhorn 2017) zugeordnet werden konnten. Hervorzuheben sind sieben Arten – Alopecosa fabrilis, Bassaniodes robustus, Centromerus capucinus, Dysdera erythrina, Micaria dives, Walckenaeria stylifrons und Xysticus luctuosus – die als verschollen oder ausgestorben (Kategorie 0) gelten. Weitere acht Arten – Agroeca lusatica, Arctosa lutetiana, Aulonia albimana, Euophrys petrensis, Gnaphosa bicolor, Liocranoeca striata, Ozyptila claveata und Xysticus luctator – sind vom Aussterben bedroht (Kategorie 1).
Neun Arten (Alopecosa schmidti, AttuClus distinguendus, Callilepis nocturna, Drassyllus pumilus, Ozyptila scabricula, Pellenes nigrociliatus, Thanatus sabulosus, Xysticus bifasciatus und Xysticus erraticus sind stark gefährdet (Kategorie 2) und weitere neun sind gefährdet (Kategorie 3): Agroeca cuprea, Alopecosa trabalis, Calositticus zimmermanni, Hypsosinga albovittata, Pellenes tripunctatus, Psammitis ninnii, Styloctetor romanus, Zelotes aeneus und Zora silvestris.
Auf den Flächen in Brandenburg wurden insgesamt 18 gefährdete Arten nachgewiesen. Nach Platen et al. (1999) sind Metapanamomops kaestneri, Micaria dives und Talavera aperta vom Aussterben bedroht (Kategorie 1), während Alopecosa fabrilis, Drassyllus pumilus, Hypsosinga albovittata und Pellenes nigrociliatus stark gefährdet sind (Kategorie 2). Die weiteren 11 Arten sind gefährdet (Kategorie 3): Alopecosa schmidti, Alopecosa trabalis, Argenna subnigra, Erigonoplus foveatus, Haplodrassus dalmatensis, Ozyptila scabricula, Pellenes tripunctatus, Psammitis ninnii, Spiracme striatipes, Styloctetor romanus und Thanatus arenarius.
Tab. 1:
Gesamtartenliste aller nachgewiesenen Spinnenarten in ausgewählten Berliner Sandtrockenrasen mit Angabe des Rote Liste-Status in Berlin (BE) (Kielhorn 2017), Brandenburg (BB) (Platen et al. 1999) und Deutschland (DE) (Blick et al. 2016) (0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, R = extrem selten, V = Vorstufe, D = Daten defizitär, kN = kein Nachweis, nb = nicht bewertet/keine Angabe, * = ungefährdet). Bestand für Berlin (BE) (Kielhorn 2017) und Deutschland (DE) (Blick et al. 2016): ex = ausgestorben oder verschollen, es = extrem selten, ss = sehr selten, s = selten, mh = mäßig häufig, h = häufig, sh = sehr häufig, nb = nicht bewertet (Für mehr Informationen siehe elektronisches Supplement (Supplement.pdf))
Tab. 1: Total species list for dry grasslands in Berlin and adjacent Brandenburg with indication of the red list status in Berlin (BE) (Kielhorn 2017), Brandenburg (BB) (Platen et al. 1999) and Germany (DE) (Blick et al. 2016) (0 = extinct or lost, 1 = critically endangered, 2 = endangered, 3 = vulnerable, G = assumed endangered, R = extremely rare, V = preliminary stage, D = data deficit, kN = no evidence, nb = not evaluated/not specified, * = least concern). Frequency in Berlin (BE) (Kielhorn 2017) and Germany (DE) (Blick et al. 2016): ex = extinct or missing, es = extremely rare, ss = very rare, s = rare, mh = moderately frequent, h = frequent, sh = very frequent, nb = not evaluated (for more details see eletronic supplement (Supplement.pdf))



Faunistische interessante Arten
Mit Metapanamomops kaestneri, Sibianor tantulus und Talavera aperta wurden drei Arten ausgewählt, die im Untersuchungsraum sehr selten sind oder bis dato nicht nachgewiesen wurden. Die weiteren sieben Arten sind aufgrund ihrer Rote Liste-Einordnung in Berlin als verschollen oder ausgestorben (vgl. Kielhorn 2017) von besonderem faunistischem Interesse.
Metapanamomops kaestneri (Wiehle, 1961)
2 Expl., Fundort: Autobahnrastplatz Niederlehme/A10 in Brandenburg, Fangzeitraum: Mai bis Juni
Metapanamomops kaestneri wurde bisher in Sandtrockenrasen und Heiden gefunden (Sacher 1995). Sie wurde bisher noch nicht in Berlin nachgewiesen, hat aber in Deutschland einen Verbreitungsschwerpunkt in Brandenburg (Abb. 2a) wo sie auf der Roten Liste als „vom Aussterben bedroht“aufgeführt wird (Platen et al. 1999), in Deutschland als „stark gefährdet“(Blick et al. 2016).
Abb. 2:
Nachweiskarten Deutschlands von a. Metapanamomops kaestneri; b. Sibianor tantulus; c. Talavera aperta (Arachnologische Gesellschaft 2019) (Kreise = Funde bis 1999, Punkte = Funde seit 2000 Punkte, rote Sterne = Nachweise aus dieser Arbeit)
Fig. 2: Distribution maps of a. Metapanamomops kaestneri; b. Sibianor tantulus; c. Talavera aperta (Arachnologische Gesellschaft 2019) in Germany (circles = records until 1999, points = record since 2000, red stars = records from this work)

Sibianor tantulus (Simon, 1868)
2 Expl., Fundorte: Berlin-Gatow nördlich „An der Gatower Heide“, Berlin-Kladow „Imchenallee“, Fangzeitraum: Mai
Sibianor tantulus präferiert vegetationsarme Rohböden wie Kies-, Sand-, und Schotterflächen (Kielhorn 2017). Sibianor tantulus konnte 2014 das erste Mal in Berlin im Naturschutzgebiet Wilhelmshagen-Woltersdorfer Dünenzug nachgewiesen werden (Schäfer 2015). Das einzelne Weibchen hielt sich in einer offenen Sandfläche im Übergangsbereich zum Sandtrockenrasen auf. Für Brandenburg gibt es bisher keinen Nachweis und die Art ist in ganz Deutschland extrem selten (Abb. 2b) (Blick et al. 2016). Ein einzelner weiterer Fund aus Sandlebensräumen stammt aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen (Mittelfranken) (Baehr 1988: als Bianor aenescens, von Logunov 2001 korrigiert).
Abb. 3:
Nachweiskarten Deutschlands von a. Alopecosa fabrilis; b. Centromerus capucinus; c. Dysdera erythrina (Arachnologische Gersellschaft 2019) (Kreise = Funde bis 1999, Punkte = Funde seit 2000 Punkte, rote Sterne = Nachweise aus dieser Arbeit)
Fig. 3: Distribution maps of a. Alopecosa fabrilis; b. Centromerus capucinus; c. Dysdera erythrina (Arachnologische Gesellschaft 2019) in Germany (circles = records until 1999, points = record since 2000, red stars = records from this work)

Talavera aperta (MILLER, 1971)
5 Expl., Fundorte: Berlin-Gatow nördlich „An der Gatower Heide“, Spandauer Forst Ost westlich „Niederneuendorfer Allee“, Döberitzer Heide, Fangzeitraum: Mai
Talavera aperta konnte in der vorliegenden Studie als Neunachweis für Berlin verzeichnet werden, im angrenzenden Brandenburg ist sie vom Aussterben bedroht (Platen et al. 1999). Die in Deutschland seltene Art wurde bisher vor allem in Südwest- und Ostdeutschland nachgewiesen (Abb. 2c) und bevorzugt trockene Lebensräume (u.a. Klapkarek 1998, Hemm et al. 2012, Staudt 2014, Kielhorn 2018a).
Abb. 4:
Nachweiskarten Deutschlands von a. Micaria dives; b. Walckenaeria stylifrons (Arachnologische Gersellschaft 2019) (Kreise = Funde bis 1999, Punkte = Funde seit 2000 Punkte, rote Sterne = Nachweise aus dieser Arbeit)
Fig. 4: Distribution maps of a. Micaria dives; b. Walckenaeria stylifrons (Arachnologische Gesellschaft 2019) in Germany (circles = records until 1999, points = record since 2000, red stars = records from this work)

Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757)
2 Expl., Fundort: Güterfelde in Brandenburg, Fangzeitraum: September
Alopecosa fabrilis ist in Deutschland vor allem im Südwesten und Osten nachgewiesen worden, sporadische Fundpunkte existieren für den Westen und Nordwesten des Landes (Abb. 3a). Die Art kommt häufig in offenen Sandgebieten vor, sowohl an der Küste als auch auf Binnendünen (u.a. Braun 1969, Baehr 1988, Bauchhenß 1995, Wiedemann et al. 2005, Krause & Assmann 2016).
Centromerus capucinus (Simon, 1884)
1 Expl., Fundort: Düppeler Forst nördlich „Stahnsdorfer Damm“, Fangzeitraum: Juni
Centromerus capucinus wurde bisher überwiegend im Südwesten Deutschlands nachgewiesen (Abb. 3b). Die Art präferiert trockene Lebensräume wie Weinberge (Lunau & Rupp 1988, Kobel-Lamparski 1989) sowie Sand- und Kalktrockenrasen (Bauchhenß 1992, 1995). Buchholz & Schirmel (2011) wiesen Centromerus capucinus in Küstendünen nach.
Abb. 5:
Nachweiskarten Deutschlands von a. Bassaniodes robustus; b. Xysticus luctuosus (Arachnologische Gersellschaft 2019) (Kreise = Funde bis 1999, Punkte = Funde seit 2000 Punkte, rote Sterne = Nachweise aus dieser Arbeit)
Fig. 5: Distribution maps of a. Bassaniodes robustus; b. Xysticus luctuosus (Arachnologische Gesellschaft 2019) in Germany (circles = records until 1999, points = record since 2000, red stars = records from this work)

Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802)
2 Expl., Fundort: Flaschenhalspark nördlich „Monumentenstraße“, Fangzeitraum: September)
Dysdera erythrina wurde vor allem in Südwest- und Mitteldeutschland häufig nachgewiesen, wohingegen für den Norden und Osten des Landes nur wenige Nachweise vorliegen (Abb. 3c). Die Art lebt in einem breiten Spektrum von Lebensräumen, so zum Beispiel in Wäldern (Dumpert & Platen 1985, Bauchhenß 2002), Trockenrasen (Perner 1997, Kreuels 2000, Buchholz & Kreuels 2009), Heiden (Kielhorn 2015), Gärten und Weinbergen (Kobel-Lamparski et al. 1993, Lisken-Kleinmans 1995).
Micaria dives (Lucas, 1846)
11 Expl., Fundorte: Biesenhorster Sand, Grünauer Kreuz, Berlin-Gatow nördlich „An der Gatower Heide“, Mahlsdorf Süd, Krummendammer Heide Berlin-Friedrichshagen, westlich Müggelsees und südlich Müggelschlößchenwegs, Autobahnrastplatz Niederlehme/A10 Brandenburg, Fangzeitraum: Mai, September
Der Verbreitungsschwerpunkt von Micaria dives in Deutschland liegt im ostdeutschen Tiefland (Abb. 4a) wo sie offene Sandtrockenrasen besiedelt (Sacher 2003, Broen & Jakobitz 2004, Martin 2014, Kielhorn 2015, 2018b).
Walckenaeria stylifrons (O. Pickard-Cambridge, 1875)
1 Expl., Fundort: Messegelände/ICC Berlin, Fangzeitraum: Juni)
Diese xerophile Art präferiert trockene und warmen Binnen-Standorte (u.a. Bauchhenß 1992, Sacher 1997, Gack et al. 1999, Sacher 2003), kommt aber auch in der Pionier-Vegetation von Küstendünen vor (Schultz 1992).
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832)
19 Expl., Fundorte: Grünauer Kreuz, Grunewald-Süd „Kronrpinzessinnenweg“, Krummendammer Heide in Berlin-Friedrichshagen, Düppeler Forst nördlich „Stahnsdorfer Damm“, Fangzeitraum: Mai, Juni, Juli)
Bassaniodes robustus gilt in Berlin als ausgestorben oder verschollen (Kielhorn 2017) und ist in Deutschland mäßig häufig (Blick et al. 2016). Die Art wurde vorwiegend in Mittel- und Ostdeutschland nachgewiesen (Abb. 5a). Sie lebt in trocken-warmen Lebensräumen wie Trockenrasen, Kalkhängen oder Geröll (Bauchhenß 1992, 2002, Perner 1997, Jakobitz & Broen 2001, Barndt 2005, Ratschker et al. 2005).
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836)
(1 Expl., Fundort: Krummendammer Heide in Berlin-Friedrichshagen, Fangzeitraum: Juni)
Xysticus luctuosus kommt vom Flachland bis zur montanen Stufe vor, wobei nur wenige Nachweise für West- und Nordwestdeutschland vorliegen (Abb. 5b). Häufiger ist die Art in Ostdeutschland, wo sie in verschiedenen, zumeist trocken-warmen Lebensräumen wie Sandtrockenrasen und Heiden (Broen 1993, Ratschker et al. 2005, Wiedemann et al. 2005, Barndt 2010) lebt.
Diskussion
Die vorliegende Studie zeigt, dass städtische Trockenrasen aus naturschutzfachlicher Sicht äußerst viele besondere Arten, die mitunter stark gefährdet und hochspezialisiert sind, beherbergen können. Viele der auf den Trockenrasen in Berlin und dem Brandenburger Umland erfassten Spinnen sind xero- und thermophile Arten, die ausschließlich offene, trockene und sandige Standorte besiedeln. Es handelt sich hierbei oft um Flächen, die einem städtischen Einfluss unterliegen, wo durch anthropogene Störungen eine für diese Arten notwendige Habitatdynamik entsteht. Auch Industrie- und Verkehrsbrachen bieten wertvolle Lebensräume, was im Zuge der Stadtentwicklung und der Flächenfolgenutzung berücksichtigt werden muss. Urbane Trockenrasen sind wertvolle Lebensräume, die durch Nutzung und eine sinnvolle Habitatpflege – vor allem in Zeit des globalen und nationalen Rückgangs vieler Invertebraten – einen wichtigen Beitrag für den Arten- und Biodiversitätsschutz leisten können. Weitere Analysen, die Zielsetzung künftiger Arbeiten sein werden, werden die Rolle der städtischen Einflussfaktoren auf die Vielfalt und Zusammensetzung urbaner Spinnengemeinschaften genauer untersuchen.
Danksagung
Diese Arbeit wurde durch das Bundesminsterium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Projektes „Bridging in Biodiversity Science – BIBS“(Fördernummer 01LC1501A-H) gefördert. Für die administrative Unterstützung danken wir der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima (SenUVK) und dem Landesamt für Umwelt des Landes Brandenburg. Für die Hilfe bei den Freiland- und Laborarbeiten sei Stefanie Abraham, Miriam Bui, Valentin Cabon, Johann Herrmann, Vicky Lange, Katja Michel, Aniko Pallmann und Julian Wendler gedankt. Für Anmerkungen zum Manuskript sei den beiden Gutachtern herzlich gedankt.
Literatur
Appendices
Anhang 1:
Koordinaten und Vegetation der in Abb. 1 dargestellten Untersuchungsflächen
Appendix 1: Coordinates and vegetation of the study sites displayed in Fig. 1